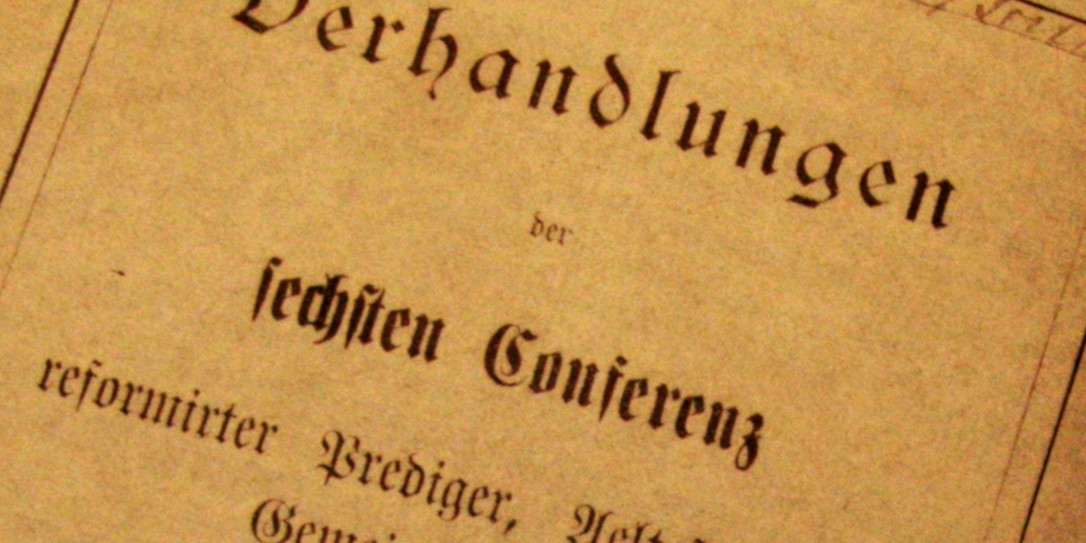Ein Gleichnis vom Königtum Gottes
Markus 4,26-29. Eine Predigt von Johannes Voigtländer

Und er sagte: So ist das mit dem Reich Gottes: Ein Mensch wirft Samen auf die Erde. Und legt sich zum Schlafen und steht wieder auf, nachts und tags. Und der Same treibt und wächst hoch, ohne dass der Mensch weiß wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre und dann vollausgereiftes Korn in der Ähre. Wenn die Frucht soweit ist, lässt der Mensch die Sichel schwingen, denn die Ernte ist da. (Markus 4,26-29)
Liebe Gemeinde!
Es ist schon faszinierend mit wie wenigen, aber sehr präzisen, sicheren und deutlichen Strichen es Jesus gelingt Umrisse, Durchblicke und Ansichten vom Reich Gottes zu entwerfen. Mit gleichsam schütteren Worten beschreibt er uns seine Vorstellung, mehr noch, zeichnet er seine Absicht, seinen Willen vom Reich Gottes in das Bild eines Menschen, einer Bäuerin oder eines Bauern, der den Samen auf dem Feld ausbringt, der sät. Es ist eine ganz alltägliche, eine völlig normale Geschichte, die von einer unabdingbar notwendigen Arbeit erzählt, eben ein Gleichnis vom Königtum Gottes.
Gerste und Weizen waren damals die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es geht also in dem Gleichnis von dem Königtum Gottes, von dem Reich Gottes, um die Grundversorgung für jeden, um den Mindestbedarf, nicht um irgendwelchen Luxus, sondern um das, was alle brauchen. Und so tritt in diesem Gleichnis – zumindest in meiner Vorstellung – der Bauer oder die Bäuerin auf, wie ein freier, unabhängiger Mensch. Mit selbstbewusstem, bedächtigem Schritt schreitet sie über den gepflügten Acker und mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen streut sie das Saatgut aus. Die sonst in den Evangelien so deutlich anzutreffende Leiderfahrung derer, die das Land anderer bebauen, weil sie selber nichts besitzen, ist hier völlig ausgeblendet. Nichts erinnert an das Elend der damaligen Landbevölkerung, nämlich Verschuldung, Schuldenturm, Enteignung und schließlich Versklavung. All das gibt es nicht mehr. „So ist das Königtum Gottes!“ Unausgesprochen, zwischen den Zeilen, ist das die erste Botschaft des Predigttextes. Markus zitiert hier auf seine Weise den Propheten Micha (Micha 4,4): „Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wir sie schrecken.“
Mich erinnert der ganze Zusammenhang immer wieder an ein Bild aus der Schrift „Deutsche Ideologie“ von Karl Marx. In seinem Bild beschreibt er das Ziel gesellschaftlicher Entwicklung als eine Situation in der niemand mehr auf einen bestimmten Beruf festgelegt ist, also frei ist und selbstbestimmt ist. Er beschreibt eine Situation in der jeder und jede alles lernen kann und dadurch wird es möglich, „heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, mittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“ (MEW 3, S. 33)
So ist das Königtum Gottes und der Text fährt fort: „Und legt sich zum Schlafen und steht wieder auf, nachts und tags.“ Im ersten Moment ist man irritiert und fragt sich, was wohl eine Bauer oder eine Bäuerin, die von der Arbeit auf dem Land ihren Lebensunterhalt erwirtschaften muss, zu diesem Satz sagen würde. Es ist ein Satz, der irgendwie unangemessen das Schlafen herauszustellen scheint und für unsere Ohren den Müßiggang und das Nichtstun betont. Dabei ist auch heutzutage, trotz Mechanisierung die Landwirtschaft ein harter Broterwerb. Nicht ohne Grund werden Jahr für Jahr Arbeitskräfte zur Ernte gesucht und vor allem unter ausländischen Arbeitern gefunden. Doch bei genauerem Hinhören wird deutlich, das Gleichnis behauptet ja nicht, dass der Mensch, nachdem der Samen gesät ist, sich auf die faule Haut legt und bis zur Ernte nur noch schläft. Es heißt ja ausdrücklich: „Und legt sich zum Schlafen und steht wieder auf, nachts und tags.“ Es geht also durchaus um den normalen Arbeitsalltag, der aus dem Wechsel zwischen Arbeit und Erholung besteht. Doch wenn ich das so sage verschiebe ich aus meiner Sozialisation heraus einen wesentlichen Akzent. Denn indem der Text zuerst vom Schlafen spricht, wird uns signalisiert, dass der Tagesrhythmus mit der Ruhe beginnt und nicht wie bei uns mit der Arbeit. Diese Akzentverschiebung im biblischen Menschenbild will ich nicht unterschlagen; denn sie wird auch in unserem Leben befreiend wirken. Befreiend, weil nicht mehr die Machbarkeit, nicht mehr der zerstörerische Anspruch alles beherrschen zu wollen und zu können, nicht mehr die Fixierung auf die Arbeit als Erwerbsarbeit im Zentrum unseres Lebens steht, die dann noch unsere Selbstwertgefühl ausmacht. Befreiend, weil wir lernen können, dass wir unsere Kraft nur aus der uns von Gott geschenkten Ruhe des siebten Tags schöpfen und damit aus der vorausgehenden Ruhe eines jeden Tages. Doch als entfesselte Menschen, die sich von Gott emanzipiert haben, stellen wir in inhumaner Selbstherrlichkeit die Arbeit vor die Ruhe. Ruhe ist aber nicht der Lohn für erledigte Arbeit, sondern Arbeit – nach biblischem Verständnis – ist nur möglich als Konsequenz, als Ausfluss, der zuvor gestatteten – nein, mehr noch –, der geschenkten Ruhe und Erholung. Kein Wunder, dass dieser Satz uns im ersten Zugang so fremd und irritierend daherkommt und zugleich ist er so wichtig.
Der Mensch in dem Gleichnis muss aber eins, er muss warten können. Sie muss warten können, bis die Frucht reif ist. Dass die Frucht reif wird, das macht der Mensch nicht. Dass die Frucht reif wird, darauf hat der Mensch, was die inneren Abläufe der Reifungsprozesse angeht, keinen Einfluss. Auch wenn wir mit riesigem technischen Aufwand die Natur auszutricksen versuchen, an den photosynthetischen Vorgängen zum Beispiel, kommen auch wir nicht vorbei. Dass die Frucht reif wird, darauf können wir nur warten. Das ist dem Bibeltext sehr wichtig; denn zweimal streicht er diesen Sachverhalt heraus. Einmal heißt es von dem Menschen, der den Samen ausstreut im Blick auf dessen Wachsen: „ohne dass der Mensch weiß wie“. Die andere Aussage schließt sich dem unmittelbar an, und es heißt dort: „Von selbst bringt die Erde Frucht.“ Im griechischen Text steht an dieser Stelle das Wort automatä – „automatisch“. Wir sind gewohnt, diesen Begriff vor allem in technischen Zusammenhängen zu verwenden. In unserem Text ist das gewiss nicht technisch gemeint; denn die Menschen hatten damals nicht unser Verständnis von Natur. Für sie war die Natur weder ein Bereich für romantische Verklärung, der etwas von Unberührtheit, Unverdorbenheit und Reinheit zum Ausdruck brachte – wie das bei uns heute in manchen Zusammenhängen der Fall ist, etwa bei der mythischen Verklärung des Labels „Bio“. Für die Menschen damals war die Natur aber auch kein Bereich technisch-manipulierender Eingriffe und Spielereien, wie wir sie heute als gentechnische Machbarkeitsphantasien unserer Agrarindustrie erleben. Natur ist für die biblischen Texte ein selbstverständlicher Bereich für Gottes Handeln. Und so selbstverständlich wie Gott in der Natur handelt, das Getreide wachsen und heranreifen lässt, ohne dass der Mensch dazu das Entscheidende beitragen kann, so ist das eben auch mit dem Reich Gottes. Gott schafft es. Gott ist es, der es heranreifen lässt. Etwas davon, dass uns das Entscheidende, dass uns die gute Gabe letztlich zuwächst und nicht von uns abhängig ist, steckt in der frechen, aber zu unserem Gleichnis passenden, Redensart, dass die „dümmsten Bauern“ die „dicksten Kartoffeln“ haben.
Wachsen lassen, warten können, Geduld haben – das gilt eigentlich für alle menschlichen Lebensbereiche. Das gilt auch für meine Arbeit in der Schule, wie für jede andere Arbeit von Ihnen. Auch da geht es nicht darum, dass wir uns auf die faule Haut legen, dass wir alles laufen ließen und uns um nichts kümmerten. Nein, so ist dieses biblische Warten nicht gemeint. Wir sind schon gefordert, aber mit unseren menschlichen Möglichkeiten, die um ihre Vorläufigkeit wissen, die nicht behaupten und in Anspruch nehmen alles und jedes beherrschen zu können. Wir merken doch gerade, wie hilflos wir vor den Auswirkungen der Finanzkrise und der Menschfeindlichkeit unseres Wirtschaftssystems stehen. Wir wissen doch alle um unsere Hilflosigkeit, wenn wir die immer nächste Drehung an der Gewaltspirale in Israel und Palästina in schrecklichen Bildern in unsere Wohnzimmer ausgeschüttet sehen. Hier warten zu können und wachsen zu lassen und gleichzeitig das Menschenmögliche zu tun, ist wohl das Widersprüchlichste der christlichen Existenz überhaupt. Aber wie der Mensch in dem Gleichnis schläft und aufsteht und sicherlich nach dem Feld sieht und eggt und jätet, aber eben nicht an den Halmen des sprießenden Getreides zieht, damit es schneller wächst und größer wird, so sind auch wir zur Geduld gerufen; denn allein Gott wirkt das Wunder, dass sein Reich kommt – auch wenn ich manchmal mehr will.
Im letzten Vers nimmt das Gleichnis Gedanken und Wörter aus Joel 4,13 auf: „Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif“. Der Zusammenhang im Joelbuch, das haben wir ja in der alttestamentlichen Lesung gehört, ist eine Weissagung. Eine Weissagung, dass Gott es den Völkern, die Israel versklavt und unterdrückt haben, heimzahlen wird. Doch für unser Gleichnis fällt es schwer, die Ernte als Gottesgericht über die Völker zu verstehen, auch wenn das im Joelbuch und in der jüdischen Deutungstradition so angelegt ist. Aber das Bild des wunderbar wachsenden Saatfeldes widerspricht dem. Trotzdem, das Bild der Sichel und der Ernte wird auch in unserem Text die Verbindung zum Weltgericht nicht los und will sie wohl auch nicht los werden, sondern sie im Hintergrund behalten, als Mahnung, als Folie, vor der sich all unser Handeln rechtfertigen muss.
Nun ist der Gedanke des Völkergerichtes dem Markusevangelium nicht grundsätzlich fremd (13,24-26; 14,62). Aber, und das ist der Akzent unseres Gleichnisses, ehe das Gottesgericht über die Völker kommen wird, haben sie noch eine Zeit zur Umkehr, haben die Völker, haben wir eine Zeit zu hören und zu sehen. Jesu Lehre und Verkündigung und die Predigt derer, die ihm nachfolgen, ruft die Völker, ruft uns, zur Umkehr. Die Markusgemeinde entwickelt hier in diesem Gleichnis vom Reich Gottes die politische Vision, die niemanden verloren geben will, selbst dann nicht, wenn sie selbst, als Gemeinde, die schlimmste Verfolgung erdulden muss. Obwohl das Wort Feindesliebe nicht einmal im Markusevangelium erwähnt wird, wird hier die Praxis der Feindesliebe beschrieben. Das ist die Praxis der Geduld, das ist die Praxis des Wartens, die Praxis des Wachsen Lassens, des Gerichts Gottes, die Praxis der Hoffnung auf Gottes Reich.
Unser Predigttext ist also ein Gleichnis für das Reich Gottes. Reich Gottes – das heißt ja, Gott ist König, Gott herrscht. Das ist für mich schon eine schwierige Vorstellung, eine Königtum, eine Monarchie zu erhoffen, bei aller Begeisterung für diesen Begriff. Vielleicht schützt uns aber auch dieser fremd gewordene Begriff einer überlebten Herrschaftsform davor, uns das Reich Gottes all zu schnell nach unseren Wünschen und Phantasien zu gestalten und damit zu missbrauchen. Reich Gottes ist da, wo er als Herr anerkannt wird, wo er zur Herrschaft gekommen ist. Und unser Text will davon erzählen, dass und wie Gott zur Herrschaft kommt. Es verhält sich damit genau so wie mit einem Menschen, der Samen aufs Land streut. In der Geschichte ist es der Same, der wächst und zur Ernte reift. Aber was ist das Mittel, mit dem Gott unter uns zur Herrschaft kommt und sein Reich heraufführt? In diesem vierten Kapitel im Markusevangelium stehen noch zwei weitere Gleichnisse, und immer geht es um Samen und um das, was aus ihm hervorwächst und an einer Stelle wird ausdrücklich gesagt, was mit dem Samen gemeint ist: das Wort, das verkündigte Wort. Das ist das Mittel, mit dem Gott zur Herrschaft kommen will. Nur das Wort? Ist das nicht allzu mickrig?
Nun haben wir auch in diesem Gottesdienst bekannt: „Ich glaube an Gott ..., den Allmächtigen“. Und wer auch sollte mächtiger sein als Gott? Manchmal wünsche ich mir seine Macht anders, dass er so richtig dreinschlägt – wenigstens ab und zu –, natürlich auf die, von denen wir meinen, sie hätten es endlich mal verdient. Und er tut’s nicht. Der allmächtige Gott zwingt uns in seiner Allmächtigkeit zu nichts. Er gebraucht das Wort, das Wort, das uns Weisung gibt, damit wir uns im Leben zurecht finden können.
Das sieht dann vielleicht alles sehr bescheiden aus. Von großer Ernte noch keine Spur. Sozusagen nur ganz kleine Hälmchen – und dann kommen womöglich noch Karnickel und fressen einen großen Teil davon ab. Es kann schon sein, dass man manchmal in der Gemeinde und Kirche und der Welt entmutigt wird. Dass es scheint, als wachse da nichts, als ginge es nicht richtig vorwärts, als müsse man immer wieder von vorne anfangen. Und da finde ich unseren Text sehr tröstlich: Es ist schon längst vor mir angefangen worden. Der Same ist da und trägt die Ernte mit Gewissheit in sich. Gottes Wort ist da und wird weiter gesagt; und es hat Verheißung, auf die ich mich verlassen kann. Es tut, was es sagt. Am Ende steht nicht die große Leere, sondern Gott und sein Reich. Und er steht nicht erst am Ende da, wie ein Drohung, sondern er will uns mit seinem Wort schon jetzt, heute, erreichen und gewinnen.
Worte, nichts als Worte? Ja, nichts als Worte. Aber ich weiß, was Worte anrichten können, und ich weiß, wie gut Worte tun können. Und ich vertraue darauf und erhoffe es mir immer wieder, dass Gott im Wort kommt, dass dieses Wort uns leitet, sie und mich, dass dieses Wort uns trägt, sie und mich. Lassen sie uns also ausgeruht den Samen ausstreuen. Lassen sie uns ausgeruht nach der Saat sehen, uns um sie kümmern, wohl wissend, wir werden das Reich Gottes nicht errichten, aber wir sollen und dürfen daran mitarbeiten. Lassen sie uns ausgeruht und geduldig auf die Ernte hoffen, deren Perspektive es ist alle Menschen mitzunehmen und niemanden verloren zu geben. Lassen sie uns geduldig, mutig und zuversichtlich auf Gottes Wort vertrauen.
Amen.
Predigt vom 8. Februar 2009, gehalten in der Reihe: "Der einfache Gottedienst", reformierte Predigten zum Markusevangelium, Melanchthon-Akademie Köln
Johannes Voigtländer
Vom 14. Dezember 2008 bis zum 13. Dezember 2009 erscheinen dreizehn Predigten zu Worten aus dem Evangelium nach Markus.