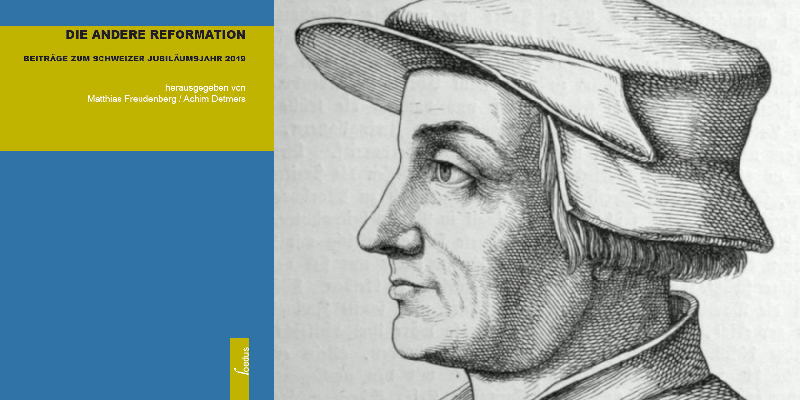'Der Maßstab zu einem guten Staat'
Interview mit Prof. Frank Mathwig

reformiert-info.de: Herr Mathwig, „Als ob wir ohne ihn etwas wären...“ - so lautet das Zitat, das Ihrem neuen Aufsatz als Thema vorangestellt ist. Das Zitat stammt aus einem Text von Huldrych Zwingli, in dem er göttliche und menschliche Gerechtigkeit gegenüberstellt. Wie kam es zu dieser Gegenüberstellung?
Prof. Frank Mathwig: Zwinglis Konzept der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit ist eng verbunden mit den persönlichen Erfahrungen des Reformators. Kirche und Staat seiner Zeit befanden sich in kritischem Zustand. Als Feldgeistlicher hatte er die Brutalität des Krieges hautnah erlebt. In der Schweiz war damals die sogenannte Reisläuferei verbreitet: Männer der ärmeren Schweizer Bevölkerung verdingten sich in ausländischen Armeen. Zwingli ging vehement dagegen vor. Als Realist war ihm klar, dass das weltliche Recht die Menschen nicht wirklich befrieden und Gerechtigkeit herstellen kann. Als eifriger Bibelleser wusste er ebenfalls um die Friedensbotschaft und Gottes Zusagen auf ein Leben in Fülle. Für ihn lag deshalb die Frage nahe: Wie kann das zusammengehen?
Was war Zwinglis Antwort?
Zwinglis Einsicht kann aus einer lutherischen Perspektive leicht missverstehen werden: Einerseits müssen göttliche Gerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit grundsätzlich unterschieden werden. Die eine hatte mit der anderen nichts gemeinsam. Die menschliche Gerechtigkeit ist notwendig, damit die Welt nicht im Chaos versinkt. Die göttliche Gerechtigkeit ist eine Realität, die sich – in weltlicher Begrenzung – in der Gemeinschaft mit Jesus Christus verwirklicht. Andererseits gehören beide Gerechtigkeiten ganz in die Welt – nicht nur in die Kirche, sondern auch in Staat und Gesellschaft. Das Leben in Christus hat für Zwingli einschneidende ethische Konsequenzen.
Das klingt trotzdem erst einmal ernüchternd: Geht es nach Zwinglis Interpretation, dann kann der Mensch die göttliche Gerechtigkeit nicht (völlig) erreichen. Trotzdem wird von ihm erwartet, genau das zu erfüllen. Ist das nicht zu viel verlangt?
Das erscheint nur auf den ersten Blick negativ oder frustrierend. Lutheraner und Reformierte teilen die Überzeugung von einer doppelten Funktion des Rechts: Einerseits sollen Gesetze den Menschen ihre Sündhaftigkeit deutlich machen. Andererseits soll die göttliche Schöpfung mit Hilfe des Rechts erhalten werden. Darüber hinaus betonen die Reformierten im Anschluss an Zwingli und Calvin einen dritten Gebrauch des Gesetzes: Das Recht leitet Christenmenschen zu einem, dem biblischen Ethos gemäßen Verhalten in der Welt an. Zwinglis Kritik an der menschlichen Gerechtigkeit ist stark geprägt von seiner Hoffnung auf die Wirkungen der göttlichen Gerechtigkeit im Hier und Jetzt. Der Zürcher Reformator lässt die Menschen mit seiner Rechtskritik also nicht im Regen stehen.
Von lutherischer Seite könnte man ihn trotzdem leicht missverstehen. Die Trennung zwischen göttlichem und menschlichem Recht klingt auf den ersten Blick nach einem Dualismus. Wie lässt sich Zwinglis Gerechtigkeitsverständnis auf Begriffe wie Staat und Kirche übertragen?
Das ist eine für säkulare Menschen irritierende Frage. Zunächst: Zwingli war ein impulsiver Geist, mit brennendem Engagement, manchmal über das Ziel hinaus. Er war nicht der große Systematiker wie Bullinger und Calvin, sondern gewissermaßen der Abraham der Reformation. Er hatte die Überzeugung, den Willen und Mut, zur reformatorischen Reise aufzubrechen und setzte viele, bis in die Gegenwart wirkende Impulse. Er nahm jenes reformierte Selbstverständnis vorweg, das im 20. Jahrhundert auf die Formel "Königsherrschaft Christi" gebracht wurde und in der Barmer Theologischen Erklärung seine konzentrierteste Gestalt fand. Im Zentrum des seither vielfach aufgenommenen Bekenntnisses steht die Einsicht Zwinglis, dass göttliche und menschliche Gerechtigkeit quer zu Staat und Kirche verlaufen. Diese Überzeugung ist strikt gegen die lutherische Arbeitsteilung gerichtet, nach der die göttliche Gerechtigkeit zur Kirche, die menschliche Gerechtigkeit zum Staat gehöre. Für Zwingli bildet die göttliche Gerechtigkeit auch den Maßstab für einen guten Staat. Aus moderner Sicht wird eine solche Auffassung als religiöse Überhöhung des Staates abgelehnt und pauschal ausgegrenzt.
Wo sind die Grenzen?
Das ist die stets neu auszuhandelnde Frage. Wir leben heute in einer post-säkularen Welt. Der Staat ist kein Heilsbringer. Aber er kann sich auch nicht darauf zurückziehen, die Frage nach dem Guten und dem Ziel staatlichen Handelns den Privatmeinungen seiner Bürgerinnen und Bürger zu überlassen. Zugespitzt: Der Staat braucht die Idee einer Autorität über ihm, solange er nicht auf so fundamentale Ideen wie die Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit des Menschen und seiner Würde aufgeben will. Zwinglis Entschlossenheit, den Staat nicht aus seiner Orientierung am Guten zu entlassen, fehlt der heutigen Politik an allen Ecken und Enden. Deshalb kann etwa auch die AfD jene Leerstellen besetzen, die der Staat mit seinen ethischen Verzichtserklärungen geöffnet hat. Der liberale Staat glaubte viel zu lange, die Frage nach dem Guten nicht stellen zu müssen. Jetzt wird sie ihm von den Falschen beantwortet.
Stichwort „von den Falschen beantwortet“: Wer ist nach Zwingli der Richtige? Wer darf überhaupt bestimmen, was Gerechtigkeit ist?
Das ist die politische Gretchenfrage seit der Antike. Die aktuellen Debatten um die Seenotrettung im Mittelmeer machen das Problem deutlich. Niemand bezweifelt ernsthaft das Unglück der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und sich auf ihrer Flucht größten Gefahren aussetzen. Bestritten wird dagegen, dass aus diesem Unglück unmittelbar Pflichten der Europäerinnen und Europäer folgen. Die politischen Debatten kreisen im Kern um die Legitimation der Nichtzuständigkeit für die Not der Menschen. Unter Verweis auf nationale Interessen wird die Unmenschlichkeit gesundgebetet und moralisch gerechtfertigt. Sich von der Not der anderen berühren zu lassen, sich durch kein Argument von dem abbringen zu lassen, was zu tun ist, lautet die Antwort der Bibel. Mit dem Philosophen Hans Jonas hätte Zwingli geraten: Sieh hin und du weißt, was zu tun ist!
Was wäre mit Zwingli die Lösung?
Allein der Gedanke Zwinglis, dass uns nichts gehört, was wir zu verteilen haben, würde unseren Blick auf die Welt vollständig verändern. Denn wenn uns nichts gehört, haben wir auch nichts, was wir gegen die Ansprüche anderer verteidigen müssten. Und damit wird jedes Argument hinfällig, zum Schutz der eigenen Privilegien anderen etwas vorenthalten zu dürfen. Zwingli stellt die Art und Weise, wie wir über Ansprüche und Rechte nachdenken, komplett auf den Kopf. Wenn uns nach der Lektüre seines Gerechtigkeitstraktats nur ein kleiner Zweifel daran käme, ob das, was wir unser eigen nennen, auch wirklich das eigene ist, dann wären wir schon sehr viel weiter.
Das Interview führte Isabel Metzger