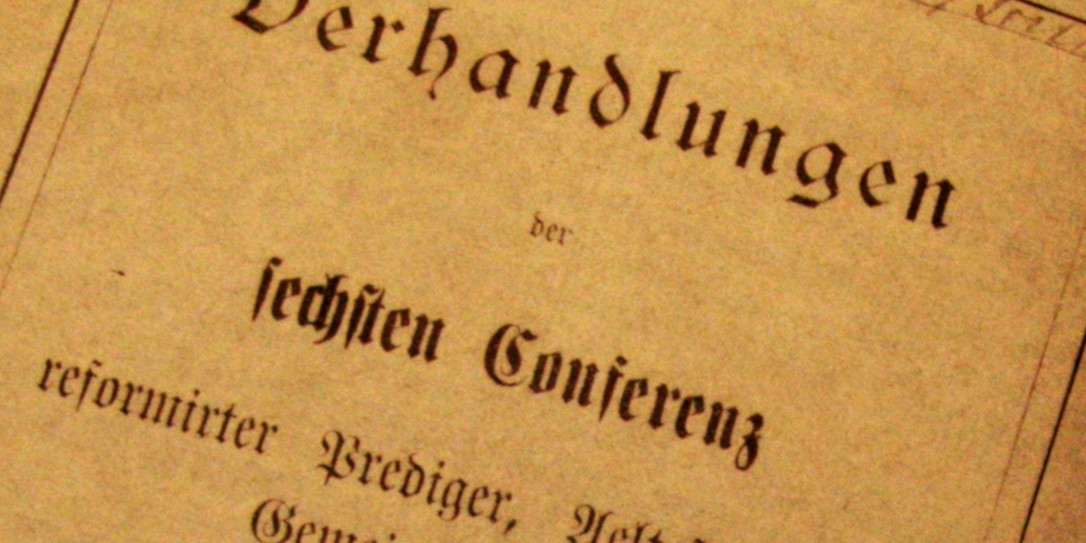Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Zwischen Toleranz und Antijudaismus
Martin Bucer und Philipp Melanchthon und ihr Verhältnis zum Judentum

Schon vor der Reformation waren die Juden Westeuropas fast vollständig aus den meisten Städten und Territorien vertrieben worden. Zu den wenigen protestantischen Territorien, in denen Juden im 16. Jahrhundert noch geduldet wurden, gehörte die Landgrafschaft Hessen unter Philipp I. (1504-1567). Auf Druck der hessischen Geistlichen kam jedoch 1539 eine Judenordnung zustande, die die Lebensbedingungen der jüdischen Gemeinden massiv beeinträchtigte. Der Jude Josel von Rosheim (1476-1554[?]), der bis zuletzt gegen die Verschärfungen in der Judenordnung angekämpft hatte, schrieb aus diesem Anlass eine Trostschrift an seine verfolgten Glaubensbrüder in Hessen.
Diese Trostschrift ist eines der wenigen erhaltenen Dokumente, die die Zeit der Reformation aus jüdischer Perspektive beleuchteten. Josel von Rosheim war Vertreter und Verteidiger der jüdischen Gemeinden in rechtlichen und religiösen Angelegenheiten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Durch seine vielen Reisen und seine zahlreichen diplomatischen Kontakte war er bestens informiert über die Situation im Reich und über die Auswirkungen der Reformation. Zudem hat er einige protestantische Fürsten und Reformatoren persönlich gekannt.
Seinem Urteil über die Reformation kommt somit einige Bedeutung zu. Und hier ist von Interesse, dass sein Urteil überaus kritisch ausfiel; Josel von Rosheim sah in den reformatorischen Neuerungen eine massive Verschlechterung für die jüdische Situation. Gleichwohl versuchte er in seiner Trostschrift zu differenzieren: Unter den Führern der Reformation gäbe es auch solche, die nicht in den verbreiteten Antijudaismus einstimmen würden. Josel erklärte diesen Umstand folgendermaßen:
”Aber dargegen gibt Gott den großen Heuptern, solchen verstanndt, daß sie auch versteent die h[eilige] geschrift, dardurch sie uns wider solche gnediglich erhalten, und keren sich nit an alle giftige geschrey über uns; Je großer die herren seint, so großer sie auch gnad von Gott haben “.
Josel von Rosheim sah also in der intellektuellen Größe einzelner führender Persönlichkeiten den Grund, dass sie aus der Heiligen Schrift die heilsgeschichtliche Besonderheit Israels erkannten und deshalb immun waren gegen das ”giftig Geschrei“ der Menge. Das begnadete Verständnis der Heiligen Schrift war für Josel von Rosheim demnach ein wichtiger Faktor für das positive Verhalten gegenüber dem Judentum.
In diesem Beitrag möchte ich untersuchen, ob dieses Urteil zutreffend ist, und danach fragen, welche Faktoren im 16. Jahrhundert die Einstellung gegenüber dem Judentum bestimmt haben. Als Beispiele dazu habe ich Martin Bucer (1491-1551) und Philipp Melanchthon (1497-1560) ausgewählt. Josel von Rosheim hat beide Reformatoren persönlich gekannt und sich in seiner Trostschrift über sie geäußert; seine Urteile fielen gegensätzlich aus: In dem Straßburger Reformator Bucer sah Josel den Inbegriff eines ”vergifteten Gemüts“, das mit seinen gefährlichen Äußerungen zum Judenhass beigetragen habe. In seiner Trostschrift notierte er:
”Aber es befremdet mich von dem Butzero dieweil er [...] on noth und gezwang, wi[e]der ein hertere disputation, wider uns armen zugericht, und [...] offentl. trugkt [= gedruckt], uns armen gar hinzulegen [= zunichte zu machen] [...]. do er aber feelt, und Gott kein wolgefallen doran hat, sollich seine geschwinde [= gefährlichen] urtheilen, so er über uns armen schreibt, würt Gott nach seinem Willen das wol offenbar machen welcher Rathgeber uß Gott oder uß vergiftem gemieth“.
Im Hintergrund stand hier der Umstand, dass Bucer 1538 für die neue hessische Judenordnung einen ”Judenratschlag“ mitverfasst hatte, in dem folgende Maßnahmen vorgesehen waren: Handels- und Wucherverbot für Juden, Ausschluss von öffentlichen Ämtern, einkommensgestaffelte Schutzgeldbestimmungen, Enteignung reicher Juden, Zwangsarbeit mit den allerniedrigsten Verrichtungen, Verbot des Baus neuer Synagogen, Verbot talmudischer Schriften, Verpflichtung zum Judeneid und zur Teilnahme an judenmissionarischen Predigten. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen wurde mit Vertreibung bzw. Todesstrafe bedroht.
Diese Vorschläge waren für die hessische Judenordnung von 1539 maßgebend, und Bucer untermauerte seine Vorschläge eigens mit einer Rechtfertigungsschrift. Diese Schrift war für Josel der Anlass, seine ”Trostschrift ahn seine Brüder wider Buceri Büchlein“ – so der vollständige Titel – zu verfassen. Anders verhielt es sich mit dem Wittenberger Reformator Melanchthon. Ihn zählte Josel zu den ”großen Heuptern“, die sich gegen antijüdische Verleumdungen gewandt hatten. In seiner Trostschrift berichtete Josel:
”Sehet jetzt auf nechst gehaltenem tag zu franckfort durch den hochgelerten Dr. Philippum Melancton ißt dem Hochgebornen fürsten und Herren, Marggr[af] Joachim [II.] von Brandenburg Churf[ü]r[st], glaubhaftig fürgepracht worden, wie von Tyrannen die armen Juden, bey seines Vattern [Joachim I.] seligen leben zu unrecht verbrannt worden “.
Diese Mitteilung bezog sich auf den Brandenburger Hostienschändungsprozess von 1510. Damals waren 38 Juden des Hostienfrevels angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Zudem wurden alle Juden aus dem Kurfürstentums vertrieben. Melanchthon aber enthüllte 1539 auf dem Frankfurter Fürstentag, dass der Brandenburger Bischof damals der Öffentlichkeit ein entlastendes Beichteingeständnis vorenthalten und den Tod der 38 Juden billigend in Kauf genommen hatte. Ein Christ, der zu Recht des Hostiendiebstahls verdächtigt wurde, hatte nämlich seinem Priester gebeichtet, dass er die Juden absichtlich verleumdet hatte. Dessen Beichteinge ständnis sei aber den Richtern und der Öffentlichkeit auf Betreiben des Brandenburger Bischofs vor enthalten geblieben.
Diese überraschende Mitteilung Melanchthons hatte zur Folge, dass Josel von Rosheim beim Kurfürsten eine Wiederaufnahme der Juden in Brandenburg erreichen konnte. Es verwundert also nicht, wenn Josel von Rosheim Bucer als gefährlichen Gegner des Judentums betrachtete, Melanchthons Eintreten auf dem Frankfurter Fürstentag jedoch als hoffnungsvolles Zeichen wertete.
Im folgenden soll nun untersucht werden, wie beide Reformatoren zu ihren Haltungen gegenüber dem Judentum gekommen sind und welche theologischen Zusammenhänge dafür ausschlaggebend waren. Dabei gilt es zunächst, die Israel-Lehren der beiden Reformatoren zu untersuchen.
1. Die Wittenberger Dialektik von Gesetz und Evangelium
Die Israel-Lehre des Wittenberger Reformators Melanchthon gilt in der Forschung als überaus ”israelfreundlich“. Im Melanchthon-Jahr 1997 wurde ihm gleich von mehrfacher Seite eine Offenheit für den christlich-jüdischen Dialog bescheinigt. Dieses Urteil bezieht sich im wesentlichen auf das Frühwerk Melanchthons, die Loci communes von 1521. Dieses Werk ist jedoch wenig aussagekräftig für Melanchthons Israel-Lehre, da er an entscheidenden Stellen zum Teil schon ein Jahr später grundlegende Veränderungen vorgenommen hat.
So wehrte sich Melanchthon z.B. in den Loci von 1521 gegen eine Auftei lung von Gesetz und Evangelium auf das Alte und Neue Testament. Zwei Jahre später jedoch betrachtete er die Gesetzespredigt als das Proprium des Alten und die Evangeliumsverkündigung als das Pro prium des Neuen Testaments. Ebenso bezeichnete er Mose in den Loci von 1521 noch als ”non iam legis minister, sed evangelista“; doch schon ab der Ausgabe von 1522 betonte Melanchthon den Unterschied
”inter Mosen et Christum, inter legem et Evan gelium. Moses veteris testamenti, hoc est, legis minister erat. Christus novi testamenti, non legis quidem, nam ea iam antea promulgata erat, ministerio Mosi, sed re missionis peccatorum.“
Außerdem plädierte er noch 1521 dafür, die Rechtsprechung an den mosaischen Gesetzen zu orientieren, da die Christen in den Ölbaum Israels eingepfropft seien (vgl. Röm 11,17). Später zeigte er sich dann zurückhaltender gegenüber einer unmittelbaren Anwendung des Mosegesetzes. Als Grundlage für die bürgerliche Gesetzgebung empfahl Melanchthon nunmehr das römische Recht. Auf mosaische Gesetze dagegen dürfe nur zurückgegriffen werden, sofern diese mit dem Naturrecht in Einklang stünden.
Und auch das paulinische Ölbaumgleichnis deutete Melanchthons immer stärker in Richtung einer Substitution Israels durch die Gläubigen der christlichen Kirche. Der Grund für diese signifikante Veränderung in der Israel-Lehre Melanchthons lag in den sog. Wittenberger Unruhen von 1521/22. Unter Berufung auf das alttestamentliche Bilderverbot hatten nämlich einige Bürger begonnen, die Bilder aus den Kirchen gewaltsam zu entfernen.
Dies führte bei Luther und Melanchthon dazu, dass sie die Bedeutung des Alten Testamentes für die kirchlichen Reformen zurückwiesen. Als schließlich auch sozial reformerische Forderungen des Bauernaufstandes (1524/25) mit dem Alten Testament begründet wurden, wandte sich vor allem Melanchthon entschieden gegen den Versuch, das mosaische Gesetz dem geltenden Recht überzuordnen und dadurch anarchische Zustände herbeizuführen. Statt dessen ging Melanchthon dazu über, das Mosegesetz dem Naturgesetz unterzuordnen.
Analog zu Luther entwickelte er die Dialektik von ”Gesetz und Evangelium“. Dieses Prinzip von ”Gesetz und Evangelium“ sah Melanchthon zwar schon im Alten Testament vertreten, wodurch er eine gewisse Einheit der beiden Testamente festhalten konnte. Doch zugleich brachte er mit dem Prinzip ”Gesetz und Evangelium“ auch die heilsgeschichtliche Gegenüberstellung der Testamente zum Ausdruck. Diese offensichtliche Spannung wird verständlich vor dem Hintergrund, dass Melanchthon die Einheit der Testamente im wesentlichen auf die Glaubensväter des Alten Testaments bezog.
Die konkreten Gesetze und Verheißungen des Alten Testaments jedoch waren für ihn von untergeordneter Bedeutung. Nur sofern sie mit dem ewig geltenden Natur gesetz übereinstimmten oder den künftigen Mittler verhießen, ragten sie gewissermaßen in den Neuen Bund hinein:
”Wiewol nu das Gesetz Moisi, seine eigen zeit gehabt, und al lein dem Jüdischen volck gegeben ist. So gehet doch das Gesetz der natur (wel ches mit den zehen Geboten uber ein stimmet) von anbe gin der Welt bis zum ende, alle Menschen, Jüden und Heiden an, Denn es ist in aller Menschen hertzen gebildet und geschrieben. [...] nach dem diese Verheissung, das ist, das Euangelium von Christo, allen Menschen von anbegin der Welt, Gottes gnade, und heil anbeut, und alle angehet, So sollen wir das wort, Testament, nicht also verstehen, als gehe es die Patriar chen oder Veter nichts an, Sondern new Testament, das ist ein new Bund, ein new wort und göttliche Ver heissung, und etwas anders und höhers, denn der bund des Gesetzes. Denn unter dem Gesetz hatten sie allein verheissung von zeitlichen dingen, des Königreichs Israel etc. Das Euangelium aber ist ein newer Bund, ein new Testament, und ein newe göttliche Verheissung“.
D.h., nur als Ausdruck des Naturgesetzes oder des Christusevangeliums war das Alte Testament für die christliche Kirche von bleibender Bedeutung. Im Blick auf die konkrete geschichtliche Ausgestaltung des alttestamentlichen Bundes hatte das Alte Testament jedoch mit dem Kommen Christi jede Bedeutung verloren. Auf die Frage, welchen Zweck der ”Bund des Gesetzes“ denn gehabt habe, antwortete Melanchthon:
”Gott wollte damals, dass das mosaische Staatsgefüge von den anderen Völkern unterschieden sei, damit es einen sicheren und offenkundigen Ort gäbe, und ein bestimmtes, kenntliches Volk, wo der Mittler geboren würde, wo die Zeugnisse von der Verheißung verkündet würden usw. Später ist dieses Staatsgefüge als abschreckendes Beispiel aus vielerlei Gründen zerstört worden.“
Das alttestamentliche Israel repräsentierte somit für Melanchthon nur den äußeren Ort, an dem Gott vorübergehend die Lehre und Ver kündigung vom kommenden Mittler aufgehoben wissen wollte. Zu diesem Zweck sei die politia Moisi mit besonderen Vorschriften und Gesetzen ausgestattet worden; diese hätten aber mit dem Anbruch des Gottesreiches unter Christus und dem Ende des jüdischen Staates (70 n. Chr.) ihre Berechtigung verloren.
2. Die oberdeutsche These von der Einheit des Bundes
Im Unterschied zu Melanchthon hat der oberdeutsche Reformator Bucer eine deutlich andere Israel-Lehre vertreten. Nicht die Dialektik von Gesetz und Evangelium bestimmte sein Denken, sondern die These von der substanti ellen Einheit des Bundes:
”Das Verhältnis von Neuem und Altem Testa ment ist im wesentlichen nicht das eines neuen Testaments, das durch Christus Bestand hat, und das eines alten [Testaments], das Gott mit den Vätern geschlossen hat. Beide sind nämlich von Grund auf idem in substantia.“
Die Besonderheit in der Bundestheologie Bucers lag darin, dass er sowohl für den Inhalt als auch für die Einrichtungen (instituta) des Alten Bundes eine Kontinuität zum Neuen Bund behauptete. Das Gesetz des Alten Bundes z.B. war für Bucer keineswegs abgetan:
”Denn das durch Mose über lieferte Gesetz Gottes [...] ist ein Gesetz, das geradlinig und vollkommen ist und die Seele dessen wiederaufrichtet, der sich selbst erforscht; es ist ein zuverlässiges Zeugnis von Gott, wodurch er den Unerfahreneren Weisheit vermittelt; es sind treffliche Anordnungen, die das Gemüt erfreuen; es sind klare Vorschriften, die die Augen erleuchten; es ist eine gewissenhafte Lehre der Religion, die ewig Bestand hat; es sind wahrhafte Grundsätze, in denen es keine Ungerechtigkeit gibt [... und] mit denen allein der Knecht Gottesrecht unterwiesen wird und, wenn er sich um sie müht, hundertfachen Lohn empfängt [vgl. Ps 19,8ff].
Diese gesetzlichen Einrichtungen (Riten, Zeremonien, bürgerliche Gesetze und Vorschriften) waren für Bucer Bestandteil des einen Bundes und auch im Neuen Bund keineswegs einfach abgetan:
”Die Gegner führen wiederholt den Grundsatz an: Die den Al ten gemachten Vorschriften seien für uns [nur] Bilder [vgl. 1 Kor 10,6], die verschwinden müssten, sobald das Wesen der Sache selbst erscheine [...]. Daraus würde allerdings folgen, dass auch die äußere Lehrtätigkeit und das Amt der Obrigkeit aufgehoben wären. Denn diesbezüglich finden wir bei Mosche viele Vorschriften, die sowohl innere und geistliche Unterweisungen sind, als auch Vorbilder und Abbildungen des Reiches Christi in den Herzen. Folglich ist im Reich Christi nicht alles abgeschafft, was bei Mosche äußerlich vor geschrieben und daher im Blick auf das Reich Christi [nur] Abbil dung und Abschattung der geistlichen Dinge war [vgl. Kol 2,17] [...]. Denn auch wir le ben noch im Fleisch [...], und deshalb haben auch wir Zere monien nötig.“
Dies galt nun allerdings nicht unterschiedslos für alle Vorschriften des mosaischen Gesetzes. Als abgeschafft galt Bucer alles, was dem spezifischen ministerium Moseos zuzurechnen sei, d.h. was nur eine auf Christus vor ausweisende Funktion gehabt habe oder nur ein Zugeständnis ( accessoria) an die Zeitumstände (circunstantiae corporales) gewesen sei:
”[...] auch in jenen äußeren [Vorschriften] hat Gott allein diese [pietas] erwartet: beim Opfern Glauben, in der Recht sprechung Liebe und bei den übrigen Riten eine anständige Lebensweise. Soweit sie aber nur Äußeres enthalten, wie das Werk selbst, den Ort, die Zeit, die Person, die Anzahl, die Beschaffenheit und andere äußere Umstände [...], auf die Gott niemals irgendeinen Wert gelegt hat, liegt es derart fern, dass Gott seine Lehre und sein Gesetz darauf errichtet hätte. Die se accessoria sind also mit Sicherheit nicht mit dem Begriff und dem Ehrentitel des göttlichen Gesetzes gemeint, obgleich die Heiligen sie zu ihrer Zeit genau beachten mussten.“
Unter diesen accessoria fasste Bucer vor allem das alttestamentliche Zeremonialgesetz. Das Judizialgesetz dagegen erachtete er für derart vorzüglich, dass es zu ”bedauern ist, dass die Christen ihre Staatsangelegenheiten weniger nach diesen Gesetzen Gottes als nach denen der Menschen regeln. [Denn] geradezu alles, was den Schutz der wahren Religion, die Regelung des zwischenmenschlichen Handels und alle Förderung von Sitte und Anstand anbetrifft, ist jenen in der Weise vorgeschrieben und überliefert worden, dass man sich nichts Vollkommeneres vorstellen kann.“
Diese inhaltliche und formale Kontinuität der beiden Testamente wurde von Bucer u.a. abgesichert durch den Hinweis, dass die Kirche keineswegs einem neuen, anderen Bund angehöre, sondern dem alttestamentlichen Bundesvolk eingepfropft sei (vgl. Röm 11,16-24; Eph 2,11-22; 3,6):
”Somit gibt es [nur] einen einzigen Wurzelstamm des Herrn, ein und dasselbe Volk [und] eben denselben Leib – vom ersten Auserwählten bis zum letzten [...]. Das neue Volk, das Gott durch den Herrn Jesus aus den Völ kern aufgenommen hat, ist es also nicht in der Weise, dass es von dem Alten verschieden ist; sondern es ist dem Alten [Volk] einge pfropft, damit es im Blick auf den Lebenswandel vor Gott stärker hervorrage.“
Durch die Aufnahme in den bereits bestehenden Bund würden die Christen auch auf die inhaltlichen und formalen Voraussetzungen des Bundes verpflichtet. Im Blick auf die Ehescheidung formulierte Bucer beispielsweise folgenden Grundsatz:
”Was der Herr seinem Alten Volk erlaubt und ins besondere vorgeschrieben hat, bezieht sich auch auf die Christen. [...] [Denn] was der Herr schon seinem erstgeborenen Volk erlaubt und vorgeschrieben hat, dies kann er den Hinzugekommenen aus den Völkern, die er zu Miterben und Miteinverleibten seines Volkes gemacht hat (Eph 3[,6]), freilich unmöglich verbieten.“
Dies bedeutete nun aber keineswegs, dass Bucer jeden Unterschied zwischen den Testamenten in Abrede gestellt hätte. Auch er benannte Unterschiede, doch waren sie bei ihm von vornherein der Lehre von den drei Epochen der Heilsgeschichte (”Triplex aetas populi Dei“35) untergeordnet. Bucer unterteilte die Heilsgeschichte nämlich in eine pueritia, eine aetas adultior und eine aetas plene virilis. Die beiden ersten Epochen repräsentierten den Alten und Neuen Bund und würden sich im wesentlichen nur durch die Intensität der Geistesgabe von einander unterscheiden. Einen gravierenden Unterschied sah Bucer erst im Übergang zur letzten Epoche, dem himmlischen Zeitalter:
”Wenngleich aber das mittlere Zeitalter, in dem das Wort des Evangeliums regiert, geistlicher ist als das der Kindheit, so ist es doch nicht ganz geistlich, wie es das volle Mannesalter, d.h. das himmlische Leben, sein wird. “
Der entscheidende Unterschied war also nicht der von Altem und Neuem Bund, sondern der von ‚Schon’ und ‚Noch-nicht’:
”Bi unns ists aber auch noch nit volku men, sonder stuckwerck, 1.Cor.13 [V.9-12]. Unnd erwarten noch, das wir das volkomen alter Chri sti erlangen. Darumb wir gleych jm mittel seind des alten unnd künfftigen volcks. “
Angesichts dieses eschatologischen Vorbehalts bewegten sich die von Bucer benannten Unterschiede zwischen Altem und Neuem Bund ausschließlich auf der Ebene einer quantitativen Differenz. Der Grund für diese deutlich andersgelagerte Israel-Lehre Bucer lag darin, dass er seine Theologie nicht wie Melanchthon gegenüber Bilderstürmern und Bauernforderungen zu profilieren hatte, sondern gegen über den täuferischen Gruppen in Straßburg. Und hier diente ihm die These von der Einheit des Bundes dazu, mit Hilfe der alttestamentlichen Kinderbeschneidung die christliche Praxis der Kindertaufe zu rechtfertigen.
Betrachtet man die Israel-Lehren der beiden Reformatoren, so überrascht das Ergebnis zunächst einmal. Aufgrund der eingangs genannten Urteile Josels von Rosheim hätte man eher bei dem erklärten Judengegner Bucer eine stärkere Abwertung des Alten Testamentes erwartet und nicht bei dem offensichtlich moderateren Melanchthon. Doch die Einschätzung des Alten Bundes hatte in der Reformationszeit ihren hauptsächlichen Ort in der innerchristlichen Auseinandersetzung; über die Verhältnisbestimmung zum Judentum sagt die Einschätzung des Alten Bundes offensichtlich wenig aus. Deshalb soll nun in einem zweiten Schritt die theologische Beurteilung des Judentums durch Melanchthon und Bucer untersucht werden.
3. Die theologische Beurteilung des Judentums durch Melanchthon
Bereits oben wurde deutlich, dass Melanchthon die Substitution Israels durch die Kirche voraussetzte. Melanchthon war der Überzeugung, dass die Juden ohne Christus verworfen seien: ”Wer nicht zum HErn Christo bekeret wird, ist gewisslich verworffen“. Zwar habe Gott bis zum Kommen Christi immer einen kleinen Rest auserwählt, um die Kontinuität der ”wahren Kirche“ zu gewährleisten. Doch sei ”in dem Israelitischen Volck zu allen zeiten schier das größte teil des Volckes Abgötisch gewesen“.
Die Verheißungen seien fleischlich missverstanden worden, durch die Einhaltung des Gesetzes glaubte man, vor Gott gerecht werden zu können und durch Opfer und Zeremonien Sündenvergebung zu erlangen. Die ”wahre Kirche“ hingegen, die die se Zustände missbilligte, wie z.B. der Kreis um die Propheten, sei von den Priestern und Leviten verfolgt worden. Dies alles habe schließlich dazu geführt, dass ”GOTTES kirch schrecklich zum sawstal und zur mördergruben gemacht“ worden sei.
Aufgrund ihres Unglaubens und wegen der Verfolgung des Evangeliums habe Gott schließlich Jerusalem durch die Römer zerstört und somit der politia Moisi ein für allemal ein Ende gesetzt:
”Er wollte, dass jene politia ausgelöscht würde, damit man einsehe, dass für die Gerechtigkeit vor Gott das Gesetz nicht notwendig ist und die Zeremonien nicht die maßgebliche [Form der] Gottesverehrung dar stellen. Wenn jene politia bestehen geblieben wäre, dann allezeit [auch] folgende Vorstellung: ‚Wir Juden haben den Vorzug; die Menschen müssen zu uns kommen und von uns das Gesetz und die Zeremonien lernen. Wir müssen das Gesetz auf alle Völker ausdehnen.’ Wünschenswert ist eine Übereinkunft im Menschengeschlecht, aber schon die Ruinen und Trüm mer Jerusalems zeigen, dass das Gesetz aufgehoben ist.“
Die politia Moisi hatte für Melanchthon vor allem den Zweck, das jüdische Volk von den anderen Völkern zu unterscheiden und für die Verheißungen und das Christusgeschehen den äußeren Rahmen abzugeben (s.o.). Nach dem Kommen Christi und der Errichtung des universalen Christusreiches habe darum die heilsgeschichtliche Sonderrolle des jüdischen Volkes ihr Ende gefunden: ”Post quam Christus apparuit, non vult amplius Deus eum populum a gentibus discerni.“
Ohne den Glauben an das wahre Evangelium blieben die Juden auf einer Stufe mit den Heiden, Muslimen und Ketzern. Wie die Muslime und Heiden würden sie Christus als Gottessohn ablehnen, ei nen Abgott anbeten und somit gegen das erste Gebot verstoßen. Ihre Kinder könnten ohne eine christliche Taufe nicht gerettet werden, sondern würden in Sünde und Verdammnis bleiben. Auch die von Juden weiterhin praktizierte Beschneidung entbehre post Christum der göttlichen Legitimation: ”Also ist der jetzigen Jüden und Türcken be schneidung kein Sacrament
mehr, Sondern sie spotten Gottes damit.“
Außerdem hielt Melanchthon die Juden für verblendete, gottlose Gesellen, die dem Machtbereich des Teufels zugehörten und dem Wahn verfallen seien, das Gesetz halten zu können. Ihre strenge Einhaltung der Sabbatruhe z.B. sei ein Ausdruck von ”Werk gerechtigkeit“ und entspringe einer abergläubischen Vorstellungswelt. Zudem würden sie immer noch der irrigen Auffassung anhängen, der Messias werde sie nach Palästina zurückbringen und dort ein weltliches Reich der Juden errichten.
Einen Grund für die Irrtümer der Juden sah Melanchthon in ihrem mangelnden Schriftverständnis. Sie hätten zwar die für das Verstehen des Alten Testaments unverzichtbare hebräische Sprache bewahrt, wegen unzureichender Kenntnisse in Dialektik und Rhetorik ermangele es ihnen jedoch an dem notwendigen Verständnis der Zusammenhänge. Durch ihre Spitzfindigkeiten, Wortverdrehungen und Halluzinationen würden sie den Sinn der Schrift nachhaltig entstellen. Dies gelte vor allem für die messianischen Verheißungen.
Auch Melanchthons Römerbrief kommentar von 1540 blieb von dieser grundsätzlich negativen Sichtweise des jüdischen Glaubens bestimmt. In seinem Kommentar ging Melanchthon davon aus, dass der Großteil des jüdischen Volkes durch eigenes Verschulden von Gott verworfen sei und jeglichen Anspruch auf die Verheißungen Israels verloren habe. In dieser Auffassung ließ sich Melanchthon auch dadurch nicht beirren, dass die entscheidenden Passagen des Römerbriefes (z.B. Röm 3,3; 9,6a; 11,1.11) gegenteilige Aussagen machen.
Vielmehr versuchte er dem drohenden Widerspruch zu begegnen, indem er herausstellte, dass für einen geringen Rest unter den Juden die Verheißungen Israels durchaus in Kraft blieben – dies aber natürlich nur, sofern sie sich zum christlichen Glauben bekehrten:
”Haben die Juden etwa deshalb die Verheißungen verloren, und ist das ganze Volk [deshalb] verworfen, weil sie nicht an Christus geglaubt, sondern ihn getötet haben? Paulus antwortet, dass die Gnadenverheißung nicht ungültig gemacht worden ist, sondern für alle, die glauben, in Geltung bleibt, auch wenn die meisten sie [d.h. die Verheißung] verschmähen.“
In der Perspektive Melanchthons hatte Gottes Treue zu Israel also nur innerhalb der christlichen Kirche Bestand; d.h. Juden müssten sich zum christlichen Glauben bekehren, um der Verwerfung des jüdischen Volkes zu entgehen. Die Warnung des Paulus vor einem (heiden-)christlichen Hochmut gegenüber den Juden (Röm 11,18-24) nahm Melanchthon zwar zur Kenntnis, sie diente ihm jedoch lediglich dazu, den Alleinvertretungsanspruch der römischen Kirche zurückzuweisen. Dennoch kam Melanchthon nicht umhin, sich mit der paulinischen
Auffassung von der endzeitlichen Errettung ganz Israels (Röm 11,25f.) auseinander zu setzen. Bereits zu Röm 9,28 vermerkte er, dass der Großteil des jüdischen Volkes am Ende der Zeit untergehen werde und nur einige wenige, die sich zum Evangelium bekehrten, errettet würden. In dieser Auffassung sah er sich auch durch Röm 11,25f. nicht ernst haft in Frage gestellt:
”Paulus fügt noch eine Weissagung von der Bekehrung der Juden hinzu, die wohl so zu verstehen ist: Es wird geschehen, dass bis zum Ende der Welt allmählich einige von den Juden bekehrt werden. Denn ich weiß nicht, ob er damit meint, dass am Ende der Welt noch irgendeine Bekehrung einer großen Menge bevorsteht. Da dies ein Geheimnis ist, sollen wir es Gott überlassen.“
Aus der endzeitlichen Errettung ganz Israels bei Paulus ist hier also die allmähliche, vorendzeitliche Bekehrung einzelner Juden geworden. Melanchthons negative Sichtweise des jüdischen Glaubens und die Auffassung von der grundsätzlichen Verwerfung des jüdischen Volkes machten es ihm offensichtlich unmöglich, den wörtlichen Sinn der paulinischen Ausführungen zu akzeptieren.
4. Die theologische Beurteilung des Judentums durch Bucer
Anders verhielt es sich bei Bucer. Er teilte zwar die negative theologische Einschätzung des Judentums, doch er hatte große Schwierigkeiten, diese Auffassung mit seiner These von der Einheit des Bundes und der Auslegung des Römerbriefes zusammenzubringen. Nichtsdestotrotz stand für Bucer fest, dass das Judentum post Christi adventum von Gott verworfen und wegen seiner zahlreichen Vergehen aus dem Land der Verheißung ver trieben wurde: ”Darumb sye dises land auch, da sye so gar von Got abgefallen waren, auß speyet und nit duldet.“ Das den Juden einst zum Leben gegebene Gesetz bringe ihnen ohne den Glauben an Christus nichts als Tod und Verdammnis. Und selbst die ihnen vormals zuteilgewordene Gnade des Bundes habe seine Wirkung verloren und sei auf die Kirche übergegangen:
”So sind auch wir längst von Natur Kinder Got tes und voll von dem Leben des rechten Ölbaums. Die Juden aber, die nun unter dem Reich des Satans leben, sind wilde Ölbäume, ohne irgendeine gute Frucht.“
Trotz dieser Eindeutigen Aussagen schwankte Bucer in seinem Urteil über die Ursache der jüdischen Verwerfung. Ei nerseits sah er die jüdische Verstockung bereits im göttlichen Ratschluss vorgezeichnet:
”Indem [...] die Juden aber durch den geheimen Ratschluss Gottes verstockt sind und zudem Christus mit dem größten Hass verfolgt haben [...], sind sie nun ganz und gar aus dem Heil herausgefallen; dass dies so geschehen musste, beweist er [d.h. Paulus] wiederum aus den Sprüchen der Propheten.“
Andererseits versuchte Bucer, den Eindruck eines willkürlich handelnden Gottes zu vermeiden; er verwies deshalb auf die Zurückweisung und Kreuzigung Christi und machte die jüdische Missachtung des göttlichen Willens für ihre Verwerfung verantwortlich:
”Gott hat in seinem geheimen, aber gerechten Urteil beschlossen, in der Zeit des offenbarten Evangeliums die meisten aus dem Volk der Juden zu verwerfen. Und die Juden haben es durch ihren Unglauben und das Vertrauen auf die Werke so verdient.“
Bucer selbst war sich jedoch darüber im Klaren, dass eine exklusive Betonung der jüdischen Verwerfung, aber auch schon die jüdische Ablehnung des Evangeliums selbst, seine These von der substantiellen Einheit des Bundes in Frage stellen musste:
”Denn weil man den Juden als einzigen zutraute, die wahre Religion stets zu befolgen, und Christus ihnen eigens verheißen worden war, verunsicherte es die meisten aus den gottesfürchtigen Völkern [...], dass keine anderen Menschen den Herrn Jesus so sehr verfluchen und so rasend verfolgen [...] wie die Juden [...]. Es schien nämlich nicht mit der göttlichen Güte zusammenzupassen, dass Gott dieses Volk, dem er sich beginnend mit dem Stammvater Abraham im Unterschied zu allen Völkern der Welt durch so vorzügliche und fortwährende Wohltaten hingegeben hatte, nun derart fallen lässt und aufgibt, so dass er ihnen – anders als allen ande ren Menschen – seinen Christus vorenthält.“
In seiner Auslegung von Röm 9-11 versuchte Bucer, dieses theologische Problem auf folgende Weise zu lösen: Er verwies zunächst darauf, dass die Verheißungen Israels nur den Erwählten gegolten hätten, nicht aber automatisch allen leiblichen Nachkommen des jüdischen Volkes. Von den Juden seien vielmehr nur einige wenige auserwählt. Dieser erwählte Rest bilde die heilige Wurzel des Ölbaumes (”radix electionis“), dem die heidenchristliche Kirche eingepfropft sei.
Sodann hob Bucer hervor, dass die übrigen Juden verblendet seien, um den Heiden einen Weg in die Gemeinschaft des Bundes zu eröffnen. Doch diese Verblendung sei nicht endgültig. Sobald sich die Vollzahl der erwählten Heiden zum christlichen Glauben bekehrt habe, werde schließlich auch ganz Israel errettet:
”Diese Verwerfung der Juden verhält sich nicht etwa so, als ob alle ohne Ausnahme verworfen sind oder die Hoffnung vergeblich ist, dass einst erneut ein besonderer Teil dieses Volkes den bis dahin nur von einem sehr geringen Überrest aufgenommenen Christus anerkennt. [...] Dieser Überrest ist freilich sehr schmal, denn es musste erfüllt werden, was über die Verblendung der Juden vorhergesagt ist – dieser Überrest also ist von der Art, dass durch ihn die Gemeinschaft des Heils zu den Völkern gelangt ist. [...] Sobald die Zahl der Heiden, die Gott ja festgelegt hat, angefüllt sein wird, werden auch die Juden wieder eingesetzt.“
Mit Paulus stellte Bucer hier also die Verstockung Israels in den Dienst der Heidenmission und ging von einem Rest erwählter Juden aus mit der Perspektive einer endzeitlichen Wiederannahme ganz Israels. Dadurch konnte er den Eindruck eines Bruchs zwischen Altem und Neuem Bundesvolk vermeiden und an seiner These der substantiellen Einheit des Bundes festhalten.
In diesem Zusammenhang wehrte sich Bucer gegen die Vorstellung, die Wiederannahme ganz Israels (Röm 11,26) beziehe sich bereits auf das neue Gottesvolk aus Juden und Heiden. Bucer hielt demgegenüber fest, dass mit ”ganz Israel“ das gesamte jüdische Volk gemeint sei:
”Sobald nämlich die Fülle der Hei den zu Christus gelangt sein wird [...], wird auch ganz Jisrael, d.h. das ganze Volk, errettet wer den und das Reich Gottes bei ihnen abermals öffentlich zur Blüte gelangen, obwohl es ihnen auch dann nicht an Verworfenen fehlen wird.“
Durch den Hinweis auf die Verworfenen inner halb des geretteten(!) Israel wird allerdings deutlich, dass Bucer keineswegs schon die endgültige Errettung des gesamten jüdischen Volkes vor Augen hatte. Er dachte offenbar nur an eine Phase kurzzeitigen Wiederauflebens der Königsherrschaft in Israel vor dem endgültigen Gericht. Er betonte zwar, ”wenn ganz Jisrael errettet werden soll, dann ist es dazu vorher [auch] erwählt worden.“ Doch in seinen An gaben zu der Frage, wie viele Juden letztlich errettet würden, schwankte Bucer zwischen plerique (die meisten)
und pauciores (recht wenige).
Unbestritten dagegen war für Bucer, dass Gottes einstige Liebe zu seinem Volk nicht in einen ”göttlichen Antijudaismus“ umgeschlagen sei:
”Gott hat sein Volk nicht verstoßen, d.h. dass er das jüdische Volk, das ihm zuvor auf einzigartige Weise zu ei gen war, nun nicht hasst, so dass jemand Gott deshalb verhasst wäre, weil er Jude ist.“
Neben dieser ungebrochenen Treue Gottes zu seinem Volk war es vor allem der Blick auf die künftige Bekehrung der Juden, durch die Bucer das Verhältnis zum Judentum bestimmt sah. Infolgedessen hielt er es für unangebracht, die Juden verächtlich zu behandeln; vielmehr müsse man alles tun, um sie für den christlichen Glauben zu gewinnen:
”dass die Wurzel der Erwählung den Juden gehört und wir Völker ih nen sogar eingepfropft werden mussten, dass Gott entschieden hat, diese Wurzel schließlich in ihnen zu bewahren, bis er sich die Juden wiederherstellt durch eine äußerst vollständige Bekehrung. Deshalb also ermahnt er die Völker, nicht gegenüber den Juden überheblich zu wer den, sondern ihnen vielmehr zum Heil zu verhelfen.“
Doch diese missionarisch motivierte Haltung gegenüber dem Judentum war nur die eine Seite. Unter Berufung auf Röm 11,28 betonte Bucer, dass man die Juden nicht nur hochschätzen solle, sondern sie wegen ihrer fortgesetzten Feindschaft gegenüber dem christlichen Glauben auch in ihre Schranken weisen müsse:
”Deshalb sollen wir sie von uns fernhalten und sie zugleich hochschätzen, sie als Feinde behandeln und als Freunde, sie bekämpfen und begünstigen. Ersteres wegen ihres gegenwärtigen Un glaubens und wegen der Heiligen aus den Völkern, die sie mit so großer Hartnäckigkeit vom Gottesreich fernzuhalten suchen. Letzteres wegen der Erwählung, die ihnen bis heute bewahrt ist, und um der heiligen Väter willen, deren leibli cher Samen bis heute in diesem Volk überdauert.“
Im Unterschied zu Melanchthon, der den Juden keine heilsgeschichtliche Rolle mehr zubilligte, ging Bucer also von der endzeitlichen Errettung ganz Israels aus und hielt es deshalb für nicht angebracht, die Juden verächtlich zu behandeln; vielmehr müsse man alles tun, um sie für den christlichen Glauben zu gewinnen. Angesichts der eingangs genannten Urteile Josels von Rosheim überrascht auch dieses Ergebnis. Denn hier ist es eindeutig Bucer, der aufgrund seiner Schriftauslegung die Möglichkeit zu einer gewissen Toleranz gegenüber dem Judentum eröffnete. Der von Josel hochverehrte Melanchthon dagegen blieb der Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium verhaftet. Er war von der grundsätzlichen Verwerfung der Juden überzeugt und sah es als seine Aufgabe an, die ”jüdischen“ Auffassungen theologisch zu bekämpfen.
Die Frage ist nun, ob sich bei Bucer und Melanchthon aus diesem Unterschied in der theologischen Beurteilung des Judentum auch Unterschiede in der konkreten Haltung gegenüber Juden ergeben haben.
5. Bucers konkrete Haltung gegenüber dem Judentum
Zum Abschluss seiner Auslegung von Röm 9-11 deutete Bucer 1536 an, wie er sich das aus Röm 11,28 hergeleitete Nebeneinander von ”bekämpfen und begünstigen“ (s.o.) konkret vorstellte. In einer observatio zu Röm 11,26 kritisierte er die ”barbarische und gottlose“ Behandlung der Juden – insbesondere die widersprüchliche und willkürliche Rechtspraxis in den Territorien und die ”arbeitsrechtliche“ Benachteiligung der Juden. Vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten hätten schwer darunter zu leiden, dass die Territorialherren den Juden hohe Steuerforderungen auferlegten, die diese dann durch überhöhte Zinsforderungen an die Bevölkerung weiter leiteten.
Neben der unangemessenen Bedrückung der Juden kritisierte Bucer aber auch, dass reichere Juden in einigen Landregionen ihre wirtschaftliche Vormachtstellung ungehindert ausüben könnten. Diese widersprüchlichen Bedingungen, denen die Juden ausgesetzt seien, wären keineswegs dazu angetan, ihre Bekehrung zu fördern. Vielmehr würden sie dadurch religiös und moralisch entfremdet.
Bevor man dafür von Gott zur Rechenschaft gezogen werde, sei es deshalb Aufgabe der christlichen Obrigkeiten, die Juden im Blick auf ihre Bekehrung zuvorkommend zu behandeln. Wenn sie aber hartnäckig bei ihrem Unglau ben blieben, solle man ihnen Gottes Fluch in Erinnerung rufen und sie zu Tätigkeiten an halten, bei denen sie niemanden mehr in wirtschaftlicher oder religiöser Hinsicht schaden könnten. Auf diese Weise sollten sie zur Annahme des christlichen Glauben gedrängt werden.
Diese Äußerungen Bucers in seiner observatio argumentierten vor dem Hintergrund einer möglichen Bekehrung der Juden. Für den Fall aber, dass die Juden sich diesem christlichen Anliegen verweigerten, ließ Bucer deutlich erkennen, dass er härtere Maßnahmen für nötig hielt. Schon in einigen seiner früheren Schriften ließ er daran keinen Zweifel. In seinem Bericht auß der heyligen geschrift von 1534 und in seinen Dialogi von 1535 gab Bucer z.B. zu verstehen, dass er das Judentum in religiöser und ökonomischer Hinsicht als eine Gefahr für die christliche Bevölkerung betrachtete. Entsprechend seinem Verständnis der Respublica Christiana drängte er darauf, die Juden als Ungläubige aus dem christlichen Gemeinwesen auszugrenzen. Sie sollten von den öffentlichen Ämtern und der Gemeinschaft des bürgerlichen Lebens ausgeschlossen
bleiben.
Wenn Bucer sich dennoch bereit zeigte, die Juden aufgrund ihrer biblischen Wurzeln zu dulden, dann nur zum Zwecke ihrer Missionierung und nur unter harten Bedingungen. Vor allem forderte er, ihre Erwerbstätigkeit auf die Sicherung des Existenzminimums zu beschränken und ihrer religiösen Betätigung enge Grenzen zu setzen. Für den Fall, dass Juden Christen in ihrem Glauben verunsicherten oder bloßstellten, drohte er mit Enteignung und Vertreibung.
Vor diesem Hintergrund sind die harten Maßnahmen, die Bucer 1538 in seinem Judenratschlag empfahl, keineswegs überraschend. Dieser Ratschlag wurde im wesentlichen von Bucer ausgearbeitet und stellte einen Kompromiss dar zwischen der Duldungsabsicht des Landgrafen und den hessischen Geistlichen und Zünften, die von einer Duldung abrieten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen basierten auf der Grundannahme Bucers, dass die Obrigkeit im Dienste der wahren Religion alle Ungläubigen aus der Respublica Christiana auszugrenzen habe.
Der Judenratschlag kam zu dem Ergebnis, dass von der jüdischen Gemeinschaft zahlreiche Gefahren ausgehen würden – vor allem für är mere und ungebildete Kreise. Genannt wurden z.B. Wucher, Betrug, Bestechung, Proselytenmacherei, Lästerung und Verunsicherung des christlichen Glaubens. Angesichts dieser Gefahren betrachtete der Ratschlag die Vertreibung der Juden als angemessene Lösung; nur unter härtesten Bedingungen sei überhaupt eine Duldung zu verantworten. U.a. forderte der Ratschlag die Heranziehung der Juden ”zu den aller nachgultigsten, müheseligsten vnd vnge wenlichsten Arbeithen, alß da sein der Berkknappen arbeit, [...] kolbrennen, schorn stein vnd kloagkh fegenn, wasenmeister sein [=Tier kadaver beseitigen] vnd der gleichenn“.
Der Gedanke einer möglichen Bekehrung ganz Israels (Röm 11,26) wurde im Judenratschlag aufgegeben, und die auf Röm 11,28 beruhende ambi valente Haltung (s.o.) wurde aufgelöst zugunsten einer religiösen und ökonomischen Repression der Juden. Galt es bisher, die Juden durch Strafandrohung von ihrem gotteslästerlichen Tun abzuhalten und sie durch besondere Wohltaten für den christlichen Glauben zu gewinnen, so bestand nun die besondere ”Wohltat“ darin, sie durch Strafmaßnahmen zum christlichen Glauben zu drängen:
”Ist jemand von denen, die straff verdienen, zu bekeren, so fördert ihn die straffe dazu. Ist jemand nicht zu bekeren, so thut man ihm doch mit der straffe so fil liebs und guts, das man im weh ret, sich selb und andere weiter zu verderben.“
Zwar betonte Bucer noch, dass die Juden aufgrund ihrer Herkunft und im Blick auf ihre künftige Bekehrung besser behandelt werden sollten als die anderen Ungläubigen. Und er verwies darauf, dass alles im Rahmen der ”Liebe“ und des geltenden Rechts zu geschehen habe. Doch oberstes Prinzip war für ihn nun, dass es keinem Ungläubigen besser ergehen dürfe als dem allerärmsten Christen:
”Ist uns dann ein ursach, die Juden zu lieben, das Christus von ihnen geporen ist nach dem fleisch [...], war umb ist uns nicht fil ein grösser ursach, die Christen zu lieben, die [...] der Herre [...] mit seinem theuren blut erkauffet und gnädiglich uffgenommen hat?“ ”warlich, bei recht gotseligem regiment müssen allemal die haußgenossen des glaubens ein vorteyl und die verechter des glaubens ein nachteyl haben [...]. Wie fil onschuldiger, frommer bauern vnd ander leut sind fro, wenn sie allein das be kommen möchten, das wir noch den Juden wolten zugeben.“
Vor dem Hintergrund einer Auslegung von Röm 11, wie sie Bucer selbst noch 1536 auf der Basis der Bundeseinheit vorgelegt hatte (s.o.), ließen sich derart repressive Maßnahmen natürlich nur schwer rechtfertigen. Selbst der Landgraf Philipp von Hessen hielt die Maßnahmen des Ratschlags für überzogen und verwies dazu auf Röm 11 und die Verheißung des erneuerten Bundes in Jer 31.
Bucer war deshalb genötigt, die Forderungen des Ratschlags biblisch-theologisch ab zusichern. Zu diesem Zweck relativierte er seine bisherige Auslegung von Röm 11 und verwies auf die traditionell antijüdisch gedeuteten Passagen des Neuen Testaments (Mt 3,7; 12,34; 16,4; 23,33; Joh 8,41-44; Act 13,45-51; 28,23-28; Röm 2,28f; 9,6-13.31-33; 10,3.19-21; 11,7-10.19f; 2 Kor 3,6-18; Gal 4,21-31; Hebr 8,13).
Das zentrale Argument seiner Überlegungen aber ergab sich nun aus der Fluchandrohung von Dtn 28. In diesem alttestamentlichen Text sah Bucer eine Handlungsanweisung für den Umgang mit Juden: Da sie Christus ermordet und die Kirche verfolgt hätten, seien die Juden als Feinde des Evangeliums von Gott verworfen. Deshalb sei es Aufgabe der christlichen Obrigkeit, den alttestamentlichen Fluch an ihnen zu vollstrecken, und d.h.
”das sie bey den vol kern, bey denen sie wonen, die vnderstenn vnd der schwanz sein vnd am aller herttestenn gehalten werden sollenn [vgl. Dtn 28,43f]“.
Diese schroffen Aussagen lassen wenig übrig von dem Exegeten Bucer, der auf der Basis der Bundeseinheit die bleibende Erwählung der Juden behauptet hatte. Auch von der Forderung, die Juden im Hinblick auf eine mögliche Bekehrung nachsichtig zu behandeln, ist Bucer in seinen Äußerungen zum Judenratschlag deutlich abgewichen.
Die Gründe für diesen ”Wandel“ Bucers sind vielfältig. Zu nennen sind hier zum einen die Rezeption antijüdischer Schriften und die Berücksichtigung hessischer Interessengruppen. Zum anderen ist das Auftauchen ”judaisierender“ Irrlehren (Antitrinitarier, Sabbatarier, Chiliasmus) von Bedeutung sowie die zunehmende soziale Polarisierung in der Bevölkerung zu Beginn der dreißiger Jahre. Vor allem der letzte Punkt scheint für Bucer entscheidend gewesen zu sein. Denn in den dreißiger Jahren beschäftigte er sich zunehmend mit den sozialen Folgen des Wuchers und ver wies immer wieder auf die Gefahren, die die gängige Praxis für ärmeren Bevölkerungsschichten mit sich brächte.
Das Beispiel Bucers zeigt also, dass das Verhältnis zum Judentum in der Reformationszeit keineswegs allein auf der Basis theologisch-exegetischer Erkenntnisse bestimmt wurde. Vielmehr konnten exe getische Einsichten von antijüdischen Traditionen überlagert und den praktischen Erfordernissen und Interessen untergeordnet werden. Das oben genannte Urteil Josels von Rosheim, dass ein begnadetes Schriftverständnis für das positive Verhalten gegenüber dem Judentum mitverantwortlich sei, findet also zumindest bei Bucer keine Bestätigung. Auch im Blick auf Melanchthon wird sich das Urteil Josels als nicht zutreffend erweisen.
6. Melanchthons konkrete Haltung gegenüber dem Judentum
In seiner Trostschrift hatte Josel von Rosheim den hessischen Juden ”den hochgelerten Dr. Philippum Melancton“ als hoffnungsvolles Beispiel auf christlicher Seite vor Augen geführt. Auf der Frankfurter Fürstenversammlung hatte Melanchthon nämlich 1539 den Justizskandal beim Brandenburger Hostienschändungsprozess von 1510 aufgedeckt. Josel konnte daraufhin eine Wiederaufnahme der Juden in Brandenburg erwirken (s.o.). Betrachtet man jedoch die theologische Beurteilung des Judentums durch Melanchthon, so lassen sich keinerlei Anhaltspunkte finden, die Melanchthons Handlungsweise auf der Frankfurter Fürstenversammlung erklären könnten.
Für Melanchthon waren die Juden ein verworfenes Volk, deren Anschauungen es theologisch zu bekämpfen galt. Deswegen ist es zunächst wenig einsichtig, warum er sich in Frankfurt (indirekt) für die Duldung von Juden eingesetzt hat. Schaut man zudem auf eine Äußerung Melanchthons, die er im Zusammenhang mit der hessischen Judenordnung gemacht hat, so dürfte dies das Urteil Josels weiter in Zweifel ziehen.
Aus dem Gespräch mit dem hessischen Hofprediger Dionysius Melander ist nämlich eine Notiz erhalten, in der sich Melanchthon kritisch über den hessischen Beschluss zur Duldung von Juden äußerte:
”Als in Hessen die Juden wieder aufgenommen wurden und ich zu Dionysius [Melander] sagte: Warum ratet ihr nicht von einer Annahme der Juden ab?, antwortete er: Ich vermag durch meinen Rat nichts zu bewirken, weil [...] die Hände des Fürsten mit dem Gold der Juden gesalbt sind.“
Diese Notiz stammt zwar nicht direkt aus der Feder Melanchthons, sondern aus einer Sammlung von Anekdoten aus seinen Vorlesungen, dennoch dürfte die Äußerung Melanchthons hier zutreffend wiedergegeben sein. Denn Melander war neben Bucer maßgeblich an der Diskussion um die Judenordnung beteiligt, und Melanchthon hatte mit ihm im Vorfeld der Verhandlungen zum Frankfurter Anstand (19.4.1539) intensiv zusammengearbeitet. Zum Zeitpunkt von Melanchthons Aufenthalt in Frankfurt a. M. (12.2.-20.4.1539) wurde außerdem zwischen den Hofpredigern, den hessischen Juden und Bucer heftig über die neue Judenordnung gestritten.
Deshalb ist es nur wahrscheinlich, dass auch Melanchthon und Melander über die Duldung von Juden gesprochen haben. Und offensichtlich stand Melanchthon der Duldung von Juden skeptisch gegenüber. Dieser Eindruck wird bestätigt beim Blick auf Melanchthons Äußerungen zu den späten Judenschriften Luthers. Überraschenderweise hat Melanchthon die beiden schärfsten Judenschriften Luthers sogar persönlich an Landgraf Philipp von Hessen übersandt. In seinem Begleitschreiben vermerkte er, dass Luthers Von den Jüden und iren Lügen ”wahrlich viel nützlicher Lahr [= Leh re]“ enthalte; und Luthers Vom SchemHamphoras übersandte er dem Landgrafen, damit dieser sehe, ”was jetzund seine [d.h. Luthers] Arbeit ist“.
Diese Büchersendungen an Philipp von Hessen können keineswegs als nebensächliche oder gar absichtslose Aktionen gewertet werden. Denn Melanchthon wusste, dass Juden in Hessen seit der Judenordnung von 1539 – wenn auch unter härtesten Bedingungen – geduldet wurden; und er konnte weder erwartet noch gehofft haben, dass die harten antijüdischen Maßnahmen, die Luther von den Obrigkeiten einforderte, den Landgrafen unbeeindruckt lassen würden. Insofern ist es nicht überraschend, dass sich der Landgraf im Januar 1543 bei Luther für die Zusendung der ersten Judenschrift bedankte und sich im April 1543 dazu ent schloss, die Judenordnung weiter zu verschärfen.
Aufgrund der Äußerung gegenüber Melander und der Übersendung der Judenschriften an Philipp von Hessen kann deshalb davon ausgegangen werden, dass Melanchthon das grundsätzliche Anliegen Luthers geteilt hat, nämlich von einer Duldung der Juden abzuraten. Auch hinter der Aufdeckung des Brandenburger Justizskandels dürfte sich keine Sympathie für jüdische Belange verbergen, sondern zwei grundsätzliche Anliegen Melanchthons: Zum einen seine an Recht und Gesetz orientierte Grundhaltung, die ihn ungerechtfertigte Vorwürfe kritisch prüfen ließ. Zum anderen dürfte die antirömische Frontstellung auf der Frankfurter Fürstenversammlung von Bedeutung gewesen sein. Am Beispiel des Justizskandals konnte Melanchthon die Skrupellosigkeit des katholischen Klerus unter Beweis stellen, der selbst vor dem Tod unschuldiger Juden nicht zurückschreckte.
Auch wenn Melanchthon – anders als es das Urteil Josels vermuten ließ – von einer Duldung der Juden eher abgeraten hat und seine Schriftauslegung kaum Wege einer Verständigung zwischen Juden und Christen eröffnete, so muss doch unterstrichen werden, dass Melanchthon im Unterschied zu Luther und Bucer sehr viel zurückhaltender war, wenn es darum ging, aus seiner theologischen Überzeugung konkrete antijüdische Maßnahmen abzuleiten. Ja, es ist vielmehr zu beobachten, dass sich Melanchthon abgesehen von den genannten Punkten an einigen Stellen dem Antijudaismus seiner Zeit verwehrte.
So stand er z.B. im Kampf gegen die Verbrennung jüdischer Bücher eindeutig auf Reuchlins Seite. Und als ihm 1556 berichtet wurde, dass einige Brandstifter in Polen, Russland und Schlesien gestanden hätten, von Türken und Juden dazu angestiftet worden zu sein, bezweifelte er den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht. Seiner Einschätzung nach war es durchaus üblich, dass Angeklagte die Verantwortung für ihre Straftaten auf andere abzuwälzen suchten. Bemerkenswert ist außerdem, dass Melanchthon an den zahlreichen Stellen, wo er sich über die Missstände im Geldgeschäft äußerte, weder auf den ”jüdischen Wucher“ zu sprechen kam noch dagegen polemisierte.
7. Ausblick
Die vorliegende Untersuchung stellte implizit die Frage, ob aus dem oberdeutsch-schweizerischen Ansatz der Bundeseinheit und der Wittenberger Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium eine je spezifische Haltung gegenüber dem Judentum abzuleiten ist. Die Frage muss aufgrund der gewählten Beispiele Melanchthons und Bucers verneint werden. Weder die ”Lutheraner“ noch die ”Reformierten“ hatten durch ihre konfessionsspezifischen Eigenarten eine feste Vorgabe für ihr Verhältnis zum Judentum.
Bucer wich von dem vorgezeichneten Weg seiner Exegese des Römerbriefes ab und schlug aufgrund der genannten Faktoren einen dezidiert antijüdischen Weg ein. Bei Melanchthon hat die antijüdische Struktur seiner Israel-Lehre keineswegs zu einer dezidiert antijüdischen Haltung geführt. Die maßgebenden Gründe für das positive Verhalten gegenüber dem Judentum lagen im 16. Jahrhundert also keineswegs im begnadeten Verständnis der Heiligen Schrift, wie Josel von Rosheim vermutete, sondern offensichtlich in Faktoren, die außerhalb der Theologie zu suchen sind.
---
Zuerst veröffentlicht in: Achim Detmers / J. Marius J. Lange van Ravenswaay
(Hgg), Bundeseinheit und Gottesvolk. Reformierter Protestantismus und Juden-
tum im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts, Wuppertal 2005, 9-37.
---
Beachten Sie für Quellenangaben die beigefügte PDF!Achim Detmers
Achim Detmers, Martin Bucer und Philipp Melanchthon und ihr Verhältnis zum Judentum. pdf >>>