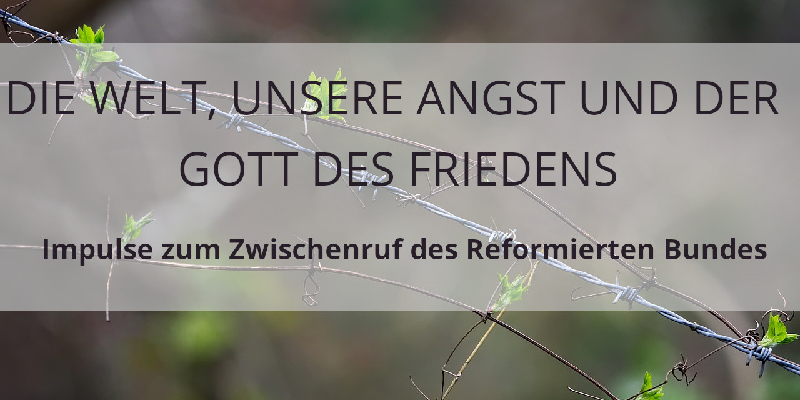Aktuelles
Aus den Landeskirchen >>>
Aus den Gemeinden >>>
Aus dem Reformierten Bund >>>
Kolumne >>>

from... - die reformierte App

Newsletter

Wir auf Facebook
'Glaube bewegt'
Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.
In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.
Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifikstaats ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten einer reichen Flora und Fauna Lebensraum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan ausschließlich von indigenen Völkern bewohnt. Dann ging die Insel durch die Hände westlicher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute beherbergt Taiwan eine vielfältige kulturelle und sprachliche Mischung. Nur etwa 2% der Bevölkerung gelten als Indigene.
Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht zurück auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. Damals flohen die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang vor den Kommunist*innen nach Taiwan. Es folgte nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung als einer der „asiatischen Tiger-Staaten“, sondern auch die Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen engagierter Aktivist*innen z.B. aus der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden im Jahr 1992 die ersten demokratischen Wahlen statt.
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hektische Alltag in den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist geprägt von Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungskosten. Und doch spielen Spiritualität und Traditionen eine wichtige Rolle.
Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Zentrum des religiösen Lebens sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen machen nur vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund um den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!
BibelTV wird über YouTube ab 19 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebettag streamen.
WGT
Der Reformierte Bund hat 2017 einen Zwischenruf zur Friedensverantwortung der Kirche veröffentlicht. Frieden sehen wir als zentrale Verheißung unserer Kirche. Am Frieden wollen wir kontinuierlich arbeiten.